Das blaue Träumen
Da war ich acht. Das Kinderzimmer flackert in Blautönen wie das Meer in der Sonne. Ich machte meine Hausaufgaben vor dem Fernseher, es ging nicht anders. Den ganzen Nachmittag liefen Animeserien und ich durfte nichts verpassen, selbst wenn ich dann drei Stunden für eine einfache Aufgabe benötigte.
Die Serien waren meine Inspiration. Ich sprang tausendmal vom Schreibtisch auf, um in meinem Zimmer die Kampfmoves nachzuahmen und Sätze nachzusprechen. Ich träumte mich schnell in die Handlungen hinein, lautstark sang ich jedes Intro mit und veranstaltete auf meinem Bett Bühnenshows wie heute Taylor Swift.
Neue Animeserien wurden schon Wochen vorab mit Trailern angekündigt. Inklusive Startdatum. Und dann erlebte ich das erste Mal One Piece.
Der Junge mit dem Strohhut und dem großen Traum, dem riesigen Ziel, für das ihn alle auslachen und niemand ernst nimmt. Aber das ist nicht schlimm: Denn er zweifelt nicht an sich, keine Sekunde.
Nichts hat mich in meiner Kindheit so geprägt wie dieser Anime. Die Hauptfigur Monkey D. Ruffy ist seit langer Zeit eines meiner größten Vorbilder und selbst heute frage ich mich noch: Was er wohl dazu sagen würde? Wie würde er in dieser Situation handeln?
Für alle, die sich mit Animes nicht so gut oder gar nicht auskennen, One Piece zählt heute zu den meistverkauftesten Mangas1 weltweit. Die Live-Action-Verfilmung auf Netflix reiht sich mit seinem Erfolg neben Wednesday und Stranger Things ein. Und die Handlung ist einfach: Vor zwanzig Jahren wurde der König der Piraten Gold Roger hingerichtet, der auf dem Schafott noch erzählt, dass er irgendwo den “größten Schatz der Welt” - das One Piece - versteckt hat, er fordert die Menschen dazu auf, ihn zu suchen. Und damit bricht das große Piratenzeitalter an. ;)
Und: Eiichiro Oda, der Mangaka, ist noch nicht einmal fertig mit der Geschichte. One Piece begleitet mich daher seit ziemlich genau zwanzig Jahren - ich wuchs auf mit dieser Serie, ich wuchs auf mit dem Jungen, der bereit ist, für seinen Traum zu kämpfen.
Daraus entstand meine erste eigene Geschichte: Ein junges Mädchen mit einem Strohhut, das gemeinsam mit ihren Freundinnen um die Welt segelt und Abenteuer erlebt. Ich habe das Buch, das aus ca. 15 A4-Seiten entstand und mit Geschenksband zusammengeknotet wurde, nicht nur geschrieben, sondern auch mit allen in meiner Klasse geteilt, die Interesse hatten. Es folgten weitere Bände. Ich habe das bis in die erste Klasse Gymnasium regelmäßig gemacht und verfolgt.
Es war die Zeit, in der ich in all die Freundschaftsbücher beim Berufswunsch und/oder bei “Das will ich einmal werden, wenn ich groß bin” schrieb: Schriftstellerin.
Ab dem Gymnasium veränderte sich vor allem die Technik. Die Themen meiner Geschichten. Es waren keine Fanfictions mehr, sondern immer mehr mein eigenes Setting, wobei ich nicht aufhörte, die Menschen meines Umfelds miteinzubeziehen. Durch eine Freundin, die Maschinschreiben besuchte, konnte ich das mitlernen. Ich erschuf meine ersten Geschichten auf einem uralten Windows-PC. Ich teilte sie weiterhin mit meinem Umfeld, bekam mal besseres, schlechteres Feedback, aber: Weiterlesen wollten sie immer alle gern.
Gemeinsam träumen
Ich versank immer tiefer in meinen Geschichten: Mit dreizehn suchte ich mir beim Einkaufen mit meiner Mama 120 Seiten Blöcke aus und schrieb im Unterricht, wenn ich mich langweilte. Reichte die Blöcke über Schulbänke weiter, damit andere die neuen/alten Geschichten auch lesen konnten. Schließlich fielen auch immer mehr die Menschen in meinem Umfeld aus meinen Geschichten hinaus. Mit 14 erfand ich alles selbst, meldete mich in dem Schreibforum Hierschreibenwir - das heute eingestellt ist - an und lernte neue Menschen kennen, die alle von derselben Sehnsucht angetrieben wurden wie ich: Geschichten erfinden und schreiben und teilen.
Aus der Schule zog ich mich hingegen immer mehr zurück. Die Zahl an Menschen, mit denen ich meine Geschichte teilte, wurde immer geringer. Das lag wohl an mehreren Faktoren: Schreiben und Geschichtenerfinden wurde peinlich, das machen doch nur Kinder. Gleichzeitig wollte ich kein Teil der Gemeinschaft sein, weil wir keine Interessen teilten: Ich saß abends gerne zuhause und schrieb und/oder las. Ich musste nicht jedes Wochenende fort, mich ekelten vor allem betrunkene Menschen an. Mit Alkohol konnte ich nichts anfangen, womit ich mich erst recht ins Aus schoss.
Aber ich war immer von Menschen umgeben, die schrieben. Ob online oder real. Selbst in der Schule hatte ich zumindest eine Person an der Seite, die auch schrieb. Ein Mädchen, das mir ihre Geschichten zeigte und sie mit mir teilte, mit der ich mich austauschen konnte. Ich fluche viel über meine Schulzeit, doch ich war immer umgeben von Menschen, die im Leben mehr sehen wollten und mussten, ich war immer umgeben von Menschen, die noch groß träumen konnten.
Während der Schulzeit beendete ich drei Romane, nur diejenigen, die sie online mitverfolgten, lasen sie ganz. Ich konnte mich nie dazu überwinden, sie zu überarbeiten oder es “wirklich” anzugehen. Ausnahme war “Und dann bin ich weg”, das ich das erste Mal einbinden lassen habe wie andere zu dem Zeitpunkt ihre Fachbereichsarbeit2, weil mir meine damalige Therapeutin erst die Bedeutung unterstreichen musste, damit ich wirklich realisierte: Ich hatte wirklich ein Buch geschrieben.
Wie Träume sich verfärben
Mit der Universität verschob sich mein Zentrum das erste Mal so richtig. Ich nahm mir nicht mehr die Zeit dafür, ich glaubte, Lehrerin zu werden und das Schreiben würde dann schon so nebenbei mitlaufen. Ich wollte in meinen Texten plötzlich besonders klug und herausragend sein, so wie die Autor:innen, die wir in der Literaturwissenschaft besprachen. Ich wollte Bedeutung und Glanz.
Ich besuchte meine ersten kreativen Schreibkurse, weil ich wissen wollte, ob ich wirklich kein Potenzial besaß. Ich arbeitete öfter nebenbei im Literaturhaus. Obwohl ich keine Romane mehr schrieb, steigerten sich meine Träume ins Unermessliche. Andere Menschen aus der Literatur, nicht nur Schreibende, erzählten mir, was sie unter Erfolg verstanden, was sie von XY hielten und warum diese Literatur ungenügend, schlecht, kitschig, zu emotional war. Überall wurde gerichtet, geurteilt und sehr genau geschaut, wer es schaffte oder scheiterte.
Und das war der Zeitpunkt, ab den ich mir dachte: Ja, davon träume ich ja auch! Eh klar.
Wenn ihr meinen Blog verfolgt, wisst ihr, dass ich mich die letzten Monate vermehrt mit der Frage beschäftigt habe: Wohin geht die Reise? Wie verdiene ich Geld mit dem Schreiben? Was bedeutet Erfolg? Welche Träume habe ich? Wie sehr halten meine Träume mich vielleicht davon ab, mein Potenzial zu entfalten? Und das wichtigste: Wie erhalte ich mir das Schreiben, wie erhalte ich mir diese riesigen Räume dafür?
Und so begann im August dieses Suchen nach Antworten.
Manchmal brauche ich Tage, oft sogar Wochen, um zu begreifen: Es ist die Scham, die am Ende all der Emotionen auf mich wartet. Die hinter meinen Träumen lauert, aber sich so gut einschleicht, dass sie zu normal ist, um sie zu entdecken. Doch sie gehört dazu und sie gehört gesehen. Denn wie peinlich ist es, als Erwachsene noch so groß zu träumen?
Genau. Gar nicht.
Die großen Träume
Die letzten Wochen dachte ich, das sind sie, meine großen Träume und meine neuen Ziele, das denke ich mir doch schon seit ein paar Jahren, als ich in das Freundebuch einer Schriftstellerin meinen größten Wunsch hineinschreiben durfte: In die Literaturgeschichte eingehen. Denn ich will doch Bestseller-Autorin werden. Ich träume davon, Säle zu füllen, auf Lesereise zu gehen, dass meine Bücher verfilmt werden und ich es schließlich schaffe, in die Literaturgeschichte einzugehen. Die klassische Vorstellung, die ich von erfolgreichen Autor:innen habe. Ich hänge an diesen Gedankenspielen, an diesen Träumen. Das will ich erreichen. Gleichzeitig stellt sich seit Ende Juli vermehrt die Frage: Wie sehr versteife ich mich auf ein konkretes Bild der Zukunft, ohne das Leben selbst weiter mitspielen zu lassen?
Alles ist so anders, als ich es mir vorgestellt habe, und zugleich auch wieder nicht. Ich habe mit Gewitter gerechnet, mit Stürmen, die mir mal den Kopf anständig reinwaschen, aber all das Unwetter hilft mir nur dabei, mich von meinen Glaubenssätzen reinzuwaschen. Wie ihr wisst, wurde mir von vielen Seiten abgeraten, dieses Risiko (Job kündigen, mal mit meinen Ersparnissen leben, die ich glücklicherweise geerbt habe) einzugehen.
Denn:
Glaube ich wirklich, dass ich in einem halben Jahr berühmt werde? Diesen einen Bestseller schreibe? Da waren schon viele vor mir, die das auch geglaubt und nicht geschafft haben! Am Ende kommen sie alle wieder in ihre Erwerbstätigkeit zurück - spar dir die Erfahrung, wenn du eh schon nur Teilzeit arbeitest. Was willst du denn noch vom Leben, wenn es schon so gut ist zu dir? Du hast doch keine Ahnung davon, wie gut es dir mit deiner Arbeit geht. Wie naiv möchtest du sein?
Ja.
Denn ich weiß noch, wie sich ein kleiner Teil in mir damals schon dachte: Ich will doch gar nicht berühmt werden. Klar, ist es schön. Klar, wünsche ich mir das, weil ich will, dass meine Geschichten gelesen werden. Klar möchte ich hauptberuflich Schriftstellerin sein, um am liebsten jeden Tag in meinen Geschichten zu versinken. Aber in erster Linie will ich einfach nur schreiben. Ich will es ausprobieren, ich will es kosten. Ich möchte nur wissen, wie das ist, wenn ich alle Räume dafür öffne. Und ich finde es hart davon zu sprechen, dass alle Menschen gescheitert sind, die sich einen anderen oder einen zusätzlichen Job gesucht haben – sie sind aus der Norm ausgebrochen und haben alles riskiert und solche Menschen sind niemals Verlierer. Außerdem bedeutet ein zusätzlicher oder ein anderer Job ja nicht, dass die Person kein:e Künstler:in mehr ist, im Gegenteil.
Ich muss mit dem Schreiben kein Geld verdienen, um es zu lieben und mich hinzugeben. Eh klar. Ich glaube aber daran, dass es möglich ist und vor allem: Dass ich das darf. Ich darf mit der Kunst Geld verdienen, die ich mache (und ein riesiges Danke an all diejenigen, die mir bereits für meinen Blog Geld gezahlt haben).
Jetzt sind wir bei dem Punkt, der mich selbst am meisten erschrocken hat: Wenn ich nur schreiben will, woher kommen dann all diese Träume?
Welche Bedürfnisse verbergen sich in meinen Träumen?
Meine Träume anhand meiner Bedürfnisse abzutasten tat weh. Auch einzusehen, dass sie mich vorrangig einschränken anstatt zu helfen, war unangenehm. Denn sie machen mir Druck, weil ich zu glauben beginne, Werbung für meine Bücher zu machen ist wichtiger, als die Bücher selbst zu schreiben. Ich fokussiere mich mehr auf das Vernetzen, ich versinke in den sozialen Medien, weil ich glaube, dass es mich schneller bekannt macht und zu diesem Ruhm bringt. Und versteht mich nicht falsch: Marketing für die eigenen Geschichten und Bücher zu machen ist unfassbar wesentlich und braucht oft sehr viel Zeit und Hingabe. Und ich werde auch nicht aufhören damit. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig es für mich ist, hier eine Waage zu finden, die mir nicht all meine Energie raubt.
Dass ich meine Träume auf ihre Bedürfnisse untersuche, habe ich übrigens aus einer BÄMZ-Folge von Mira (ja, die Mira mit dem fliegenden Haus!). Meine Träume spiegeln einerseits meine Sehnsucht wider, gesehen zu werden, der gesamten Welt zu beweisen, dass ich existiere, weil ich eben das Mädchen war, das gefühlt ihre gesamte Jugend lang ignoriert und nicht gehört wurde. Andererseits verwechsle ich Ruhm offensichtlich mit dem Drang nach Freiheit. Viel Zeit zu schreiben? Das muss bedeuten, viele Bücher zu verkaufen, Listen zu sprengen, auf Lesereise zu gehen.
Ausgerechnet der Anime Haikyuu! hat mir gezeigt, was ich will. (Spoiler zu Anime/Manga folgen!)
Ich habe viele Ähnlichkeiten mit dem Weg von Hinata Shoyo, was sein Volleyball-Training und meinen Schreibprozess betrifft. Hinata verliebt sich in den Sport, er empfindet die größte Freude dabei und kann zu Beginn schnell rennen und hoch springen, aber beherrscht keine Technik, noch dazu ist er für einen Volleyballer im Angriff eher klein. Er muss sich jeden einzelnen Schritt erarbeiten. Am Ende des Mangas wird er Nationalspieler, er wird ein richtig bekannter und grandioser Profi. Aber warum eigentlich? Sicher nicht wegen des Ruhms und damit ihn die Welt kennt, sondern wegen der Freude. Der Weg hat sich letztlich so ergeben, denn sein Ziel ist: Ich will weiter auf dem Platz bleiben und Volleyball spielen. Ich will immer besser werden und viele Spiele spielen. Es ist nur eine Form der Freiheit. Und diese Erkenntnis schlug ein. Denn berühmte Beststeller-Autorin zu sein wird mich nicht freier machen als jetzt, wo kaum jemand weiß, wer ich bin. Und das ist der Punkt: Ich will nicht berühmt werden, um berühmt zu sein, ich will einen Weg finden, um durchgehend und viel schreiben zu können.
Gehören meine Träume wirklich mir?
Das Schreiben war für mich immer mein Raum, der immer mir gehörte. Mein sicherer Platz, der einzige Ort, an dem ich mich nicht zu verstecken brauchte. Niemals hätte ich gedacht, dass mich andere Menschen doch darin beeinflussen könnten, wie sie mich gerne als Schriftstellerin hätten.
Es ist dieser Satz, der mir durch den Geist wabert: “Und wenn du einmal diesen Bestseller geschrieben hast…”, was im Übrigen nicht stimmt. Ein einziger Bestseller sorgt nicht dafür, rein vom Schreiben leben zu können. Aber das ist wie ein fieser Glaubenssatz. Du musst das und das erreichen, damit das und das geschehen kann. Erst wenn ich ein Buch veröffentlicht habe, eine stabile Lebensunterlage mit dem Schreiben verdiene, dann kann ich all die anderen Jobs verlassen, dann darf ich die Ausbildung schmeißen, dann darf ich wirklich das tun, was ich liebe und mich darauf konzentrieren. Ich muss die Kunst erst liefern, um sie mir zu verdienen. Ich muss erst beweisen, wer ich bin, um ich sein zu können. Ich habe darauf gewartet, dass meine Umstände mich frei machen und mir andere Menschen sagen: Jetzt darfst du Künstlerin sein.
Von dem Aspekt einmal abgesehen, wie anstrengend und nervenaufreibend das ist (weil Schreiben heutzutage nicht mehr nur Schreiben ist, weil es immer auch um Marketing geht, ums Netzwerken, um Blaupausen, die es braucht, um die Fantasie zu entlasten und zu fordern), ist es natürlich vernünftig, klug und absolut okay, sich erst eine sichere Grundlage zu schaffen. Aber ich durfte aufgrund einiger finanzieller Privilegien erstmal einen anderen Weg einschlagen. Und ich frage mich aus dieser Position häufig: Was hätte ich alternativ getan? Mittlerweile bin ich überzeugt, dass ich mir einen anderen Job gesucht hätte, der mich kreativ nicht so fordert wie der alte, z.B. so etwas wie die Datenbank-Arbeit, von der ich in meinem September-Logbucheintrag erzähle, und die ich gerade mache.
Das Abenteuer, das mich lebendig macht
Ich träume ohne Scham. In allen Größen und Farben. Ich gebe mich gerne der Fantasie hin, Bestseller-Autorin zu sein, denn auch wenn meine Bedürfnisse sich darin verbergen, erinneren sie mich daran: Die Welt darf mich sehen. Ich traue ihr meine Geschichten zu.
Woran ich mich aber vor allem erinnert habe: Mein blauer Traum gehört jetzt wieder mir. Das ist es, wie ich leben will und was ich mir erfüllen möchte.
Vielleicht verstehe ich jetzt endlich, warum Ruffy keine Zweifel hat und sich nicht reinreden lässt: Er braucht keine Bestätigung, weil es für ihn das Richtige ist. Niemand kann ihm seinen Traum wegnehmen, er benötigt weder Lob noch Kritik, er will niemanden damit beeindrucken oder provozieren. Er braucht nicht darauf zu warten, dass ihn jemand sieht, denn er sieht sich selbst. Er geht einfach seinen Weg und schaut, wo er landet. Denn seinen Traum zu verfolgen, das macht ihn lebendig und bringt die Abenteuer ganz von selbst.
So wie mein Traum.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für mich und meine Träume genommen hast. Wenn dich mein Text angesprochen hat, freue ich mich, wenn du meine Kunst so unterstützt, wie es dir gerade möglich ist:
Danke dir von Herzen, dass du hier bist. Pass auf dich auf und wir lesen uns.

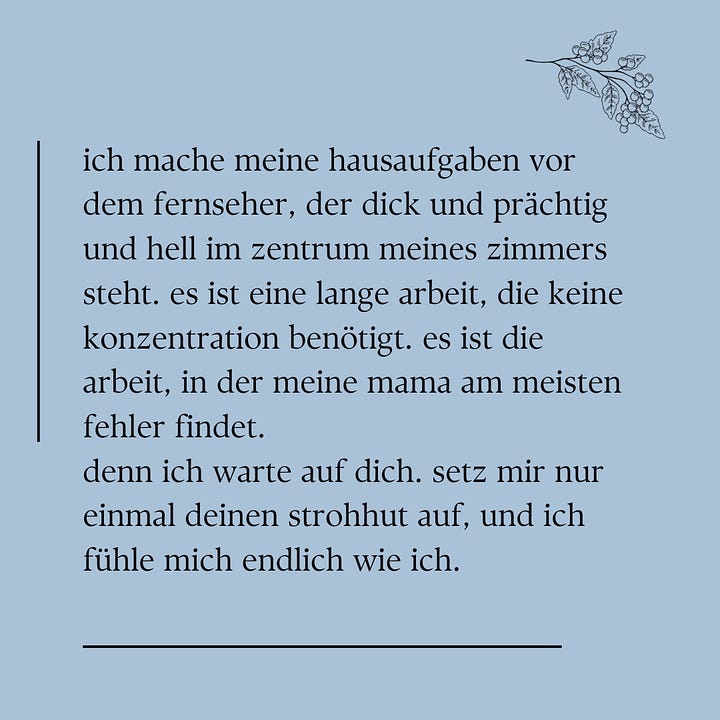
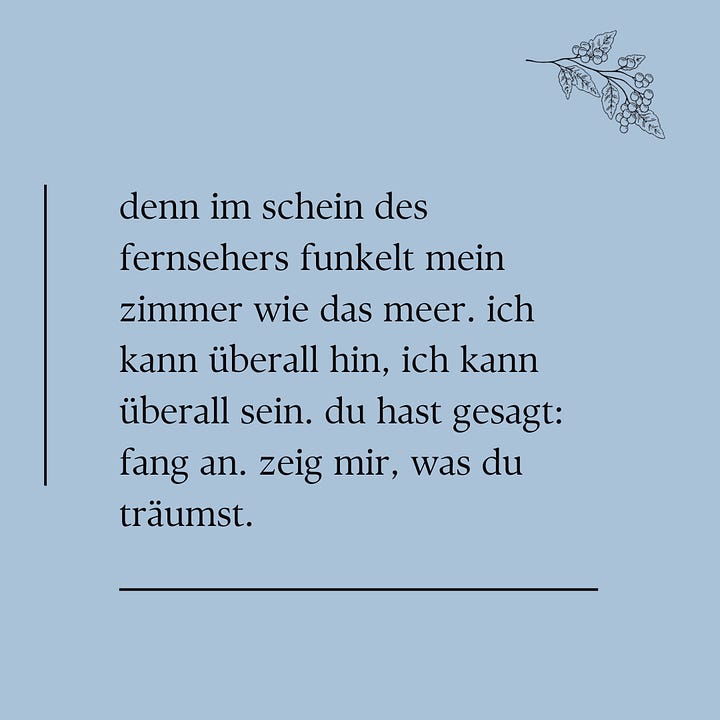
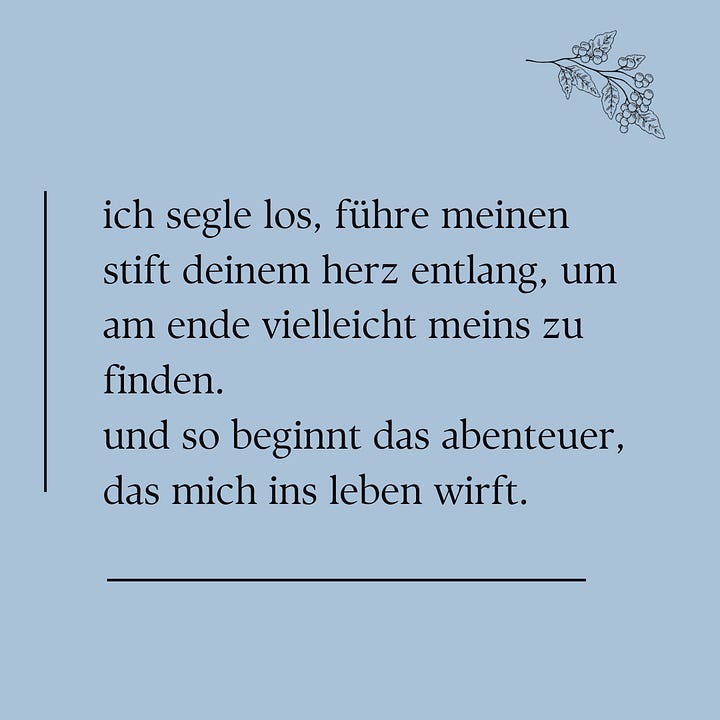
Anime bezeichnet in Japan produzierte Zeichentrickfilme und -serien. Manga ist in vielen Fällen das kleine Buch dazu (eine Art Comic), das mensch seitenverkehrt liest.
Früher (also vor der Zentralmatura 2015 in Österreich) gab es noch die Möglichkeit, eine Fachbereichsarbeit zu schreiben, um eine Prüfung bei der Matura weniger machen zu können. Heute ist es die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA), die aber alle Schüler:innen schreiben müssen, die zur Matura antreten.









Puh, ich würde gern irgendwie sinnvoll antworten - aber du hast mit deinen Worten so ziemlich jeden Punkt abgedeckt, den ich nutzen könnte.
Ich schreibe selbst, nicht um berühmt zu werden. Sondern um zu erschaffen.
Alles andere kommt später. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Träumen wir weiter und arbeiten an der Realisierung vielleicht noch. Und zuletzt: Ich mochte immer Ace :) Und Nami, wenn sie Karten gezeichnet hat.
"Ich träume ohne Scham." 😭 Ich liebe diesen Absatz! Danke für all diese Gedanken, bei denen ich mich wieder einmal ertappt fühle. Und gleichzeitig erinnert es mich daran, was für ein kreativer Luxus es ist, nicht vom Schreiben leben zu müssen. Dass ich diese Freiheit auch genießen darf ... fürs Erste. 🤍